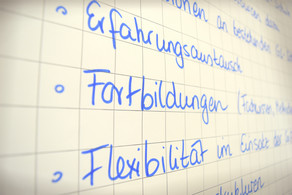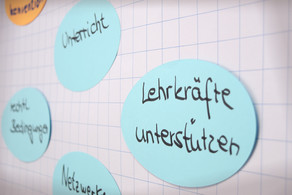Modulübersicht und Termine
Module
Deutsch als Zweitsprache - Grundlagen
A1: Einführung in die relevanten sprachlichen Dimensionen: Sprache, Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, kulturelle Identität
- Vermittlung der Notwendigkeit von „Deutsch als Zweitsprache“ in allen Fächern
- Mehrsprachigkeit in Gesellschaft und Schule
- Formen und Funktionen von Sprache in problemrelevantem Zuschnitt: Sprachliches Handeln und Wissen, Wortschatz und Begrifflichkeit, Grammatik, Lautstruktur und Schrift (mit Sprachvergleichen zu Herkunftssprachen, einschl. interkultureller Aspekte
- Zweitspracherwerb im Überblick
- Erste und zweite Sprache: Zugänge zu Problemfeldern des Erwerbs und Hürden im Lernprozess
A2: Relevanz von Sprache und schulischer Bildungs- und Fachsprache für Lernprozesse und die Entwicklung von Sprachfähigkeit im rezeptiven und produktiven Bereich
- Zugänge zur Analyse sprachlicher Handlungsfähigkeit am Beispiel von Wortschatzentwicklung als Grundlage für Bildungssprache und den Aufbau von Fachwortschätzen
- Strategien zur Informationsentnahme aus längeren Hörtexten und aus anspruchsvoller Fachkommunikation
- Erarbeitung von Strategien zur Verbesserung des Leseverständnisses von schulischen Fachtexten
- Zugänge zu Schreibstrategien und Schreibroutinen in fachsprachlichen Texten
Deutsch als Zweitsprache im Kontrast
B1: Strukturen des Deutschen, die für Erwerb und Vermittlung relevant sind
- Sprachtyp, Spezifika, Verbreitung
- Lautsystem und Schrift
- Wortarten, Wortgruppen, Satzfunktionen (Satzglieder)
- Redegegenstände: Nominalgruppe, Personalformen etc.
- Gedanken formulieren: Verb, Verbgruppe etc.
- Adverbien, Präpositionen, Partikelarten
- Komplexe Sätze
- Lineare Abfolge und Gewichtung
- Mögliche Kontrastbereiche im Verhältnis zu Herkunftssprachen
B2: Strukturen einer Herkunftssprache, die für den Zweitspracherwerb relevant sind
- Lautsystem und Schrift
- Wortarten, Wortgruppen, Satzfunktionen (Satzglieder)
- Redegegenstände: Nominalgruppe, Personalformen etc.
- Gedanken formulieren: Verb, Verbgruppe etc.
- Adverbien, ggf. Präpositionen, Partikelarten
- Komplexe Sätze
- Lineare Abfolge und Gewichtung
- Kontraste zum Deutschen
Schrift, Text, Handlungsfähigkeit
C1: Schrift und Orthographie – Erwerb und Vermittlung
Grundlagen zu Schrift und Orthographie, ihrem Erwerb und ihrer Vermittlung
- Schrift, Schrifttypen, Schriftsysteme, Mehrsprachigkeit und Mehrschriftlichkeit, Lautsystem und Silbenstruktur des Deutschen
- Orthographie des Deutschen: Interpunktion, Wortschreibung, silbisches und morphologisches Prinzip, Graphem-Phonem-Korrespondenzen
- koordinierte Alphabetisierung, Zweitalphabetisierung
C2: Literatur, Medien, Interkulturalität
Grundlagen für die kritische (Selbst-) Reflexion des Lehr/Lernarrangements
- Migration und kulturelle Differenz als Gegenstand zeitgenössischer Medien und Literatur (Internet, Fernsehen, populärer Film und Literatur)
- Theorien und Analysen zur Konstruktion von Eigenem und Fremden
- Verfahren kultureller Wissensverarbeitung (Image, Stereotypisierung etc.)
- Analyse von Unterrichtsmaterialien in Bezug auf die Wahrnehmung kultureller Differenzen
- Möglichkeiten von kritischer Reflexion und Perspektivenwechsel.
Sprachförderung und Unterricht unter den Bedingungen von Mehrsprachigkeit/in Vorbereitungsklassen
D1: Grundlagen der Sprachförderung
- Diagnoseverfahren (Profilanalyse, C-Test, Wortschatztest etc.)
- Lernstandsanalyse, Bedarfsanalyse, Unterrichtsplanung, Unterrichtsinteraktion
- Übungstypologie, Lehrwerke für A1-, A2-, B1-Niveau (Aufbau, Auswahl, Progression)
- Wortschatzarbeit: zu vermittelnder Wortschatz (basal, fachlich), Bezug auf Unterrichtsmaterial
- Grammatikarbeit: Grundgrammatik, Form und Funktion sprachlicher Ausdrucksmittel, Vermittlung eines exemplarischen Bereichs der Grundgrammatik
- Spezifische Arbeit mit Geflüchteten und mit Seiteneinsteiger(innen) (Sprachwissen, Schrift der Erstsprache(n) etc.)
D2-a: Unterricht unter den Bedingungen von Mehrsprachigkeit, Sprachförderung in Vorbereitungsklassen
- Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer erkunden und dokumentieren
- Förderassistenz in einer Vorbereitungsklasse
- Projekt zur Mehrsprachigkeit planen und durchführen
- Sozialformen nutzen: Mentorschüler/innen, Tandemarbeit, Kleingruppenarbeit und individuelle Förderung
- Formen spielerischer Sprachförderung
- Probleme der Unterrichtsinteraktion: Verständigungsprozesse unter mehrsprachigen Bedingungen
- Übergang zum Regelunterricht gestalten
oder
D2-b: Unterrichtshospitation im DaZ Bereich
- Integrationskurs, Schulunterricht oder in Absprache mit vergleichbarer DaZ-Lehre im Umfang von 10 UE à 45 Minuten und bearbeiteter Feedbackbogen sowie kritische Reflexion (mind. 5 Seiten)
Deutsch als Zweitsprache im gesellschaftlichen (beruflichen/ institutionellen) Kontext
E1:Handlungsfähigkeit und Textkompetenz (Muster und Vermittlung)
- Großformen sprachlichen Handelns (Erzählen, Nacherzählen, Inhaltsangabe, Beschreiben, Erklären, Berichten, Instruieren)
- Bewertende sprachliche Handlungen (Einschätzen, Kommentieren, Kritisieren)
- Argumentieren (mündlich, schriftlich)
- Autobiografisches Erzählen, Sprachbiographien
- Bedarfsanalyse; sprachliche Anforderungen von Lehrbuchtexten (Fach- und bildungssprachliche Ausdrucksmittel, Verknüpfung und thematische Fortführung, Mittel der Gewichtung)
- Texte schreiben im Unterricht:: Schreibaufgaben, kooperative Textplanung und -revision
E2: Institutionelle einschl. berufliche Kommunikation
- Grundlagen institutioneller Kommunikation
- Grundelemente des deutschen Rechts, Kommunikation im Recht (Anzeige, Gerichtskommunikation, Anwaltsgespräch) und Rechtssprache
Verträge (Kaufverträge, Mietverträge usw.)
Behörden und Verwaltung (Korrespondenz, Formulare, Anträge)
Telefonate und Korrespondenzen im Alltag (als Mieter, als Kunde, als Bürger), Verkaufs-, Reklamationsgespräch (Schalter, Hotline) und -text - Kommunikation in Gremien (Genossenschaft, Verein): Tagesordnung, Protokoll, Antrag,
- Arzt-Patienten-Kommunikation,Beratungsgespräche, therapeutische Gespräche
- Kommunikation in der Schule unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit (Unterricht/Lern- und Arbeitsgruppen, Eltern, Beratung): Dokumentation und Analyse (Muster, Sprachformen)
Exemplarisch Arbeitsplätze erkunden, - Kommunikation am Arbeitsplatz exemplarisch dokumentieren und analysieren
- Besprechungen, Verhandlungen, Konferenzen (auch medial: Video, Telefon, Chat)
Bewerbungen formulieren, Bewerbungsgespräche führen - Gespräche, Simulationen, Rollenspiele, Präsentationen in der Ausbildung
Termine 2022/23
| Block 1: | 05. & 06. Oktober 2022 |
| Block 2: | 19. & 20. Oktober 2022 |
| Block 3: | 02. & 03. November 2022 |
| Block 4: | 16. & 17. November 2022 |
| Block 5: | 30. November & 01. Dezember 2022 |
| Block 6: | 14. & 15. Dezember 2022 |
| Block 7: | 11. & 12. Januar 2023 |
| Block 8: | 25. & 26. Januar 2023 |
| Block 9: | 01. & 02. Februar 2023 |
| Block 10: | 22. & 23. Februar 2023 |
| Block 11: | 08. & 09. März 2023 |
| Block 12: | 22. & 23. März 2023 |
| Block 13: | 05. & 06. April 2023 |
| Block 14: | 26. & 27. April 2023 |
| Block 15: | 03. & 04. Mai 2023 |
| Block 16: | 16. & 17 Mai 2023 |
| Block 17: | 31. Mai & 01. Juni 2023 |
| Block 18: | 28. & 29. Juni 2023 |
| Block 19: | 05. Juli 2023 |
| Zertifikatsprüfung: 13. & 14. September 2023 | |
mittwochs 14:00 – 17:30 Uhr, donnerstags 09:00 – 16:30 Uhr
Stundeneinteilung
Mittwoch | Donnerstag |
| 14:00 - 15:30 Uhr | 09:00 - 10:30 Uhr |
| 30 Min Pause | 15 Min Pause |
| 16:00 - 17:30 Uhr | 10:45 - 12:15 Uhr |
| 1 h Mittagspause | |
| 13:15 - 14:45 Uhr | |
| 15 Min Pause | |
| 15:00 - 16:30 Uhr |
Anwesenheit
Es besteht Anwesenheitspflicht bei dem Kurs. Die Anwesenheit bei den Präsenzterminen ist sehr wichtig, da dort im gegenseitigen Austausch Inhalte erarbeitet und diskutiert werden. Daher sollte es auch in Ihrem Interesse sein, an allen Terminen teilzunehmen. Bitte klären Sie im Vorfeld mit Ihrer Schulleitung (und der Bezirksregierung) oder Ihrem Vorgesetzten/ Ihrer Vorgesetzten, ob eine Freistellung möglich ist.